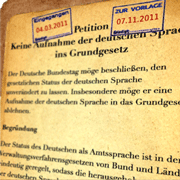Ab und zu fehlen selbst den eloquentesten Mitgliedern einer Sprachgemeinschaft die Worte — dann nämlich, wenn deren Sprache für einen bestimmten Sachverhalt schlicht kein Wort bereitstellt. In der Sprachwissenschaft spricht man hier allgemein von lacunae, oder, weniger latinisiert, von „lexikalischen Lücken“.
Interessant sind diese Lücken natürlich nur dann, wenn ein Wort für einen an sich bekannten Sachverhalt fehlt, und nicht dann, wenn ein Wort fehlt, weil das zu Bezeichnende selbst unbekannt ist. Das Deutsche hatte bis in die 1990er Jahre kein Wort für Sushi, aber weil niemand das damit bezeichnete Gericht überhaupt kannte, fehlte das Wort ja nicht im eigentlichen Sinne. Man könnte also etwas präziser von „Versprachlichungslücken“ sprechen (aber das ist eine Eigenkreation, kein anerkannter Fachbegriff).