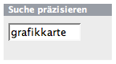Es ist sicher immer schwer, der Öffentlichkeit die Notwendigkeit von Grundlagenforschung verständlich zu machen. Aber man stelle sich vor, eine Gruppe von Physikern hätte von der Regierung 670.000 Euro erhalten, um die Anzahl und die Eigenschaften von Elementarteilchen zu erforschen (nicht, dass sie damit weit kämen — man könnte mit dieser Summe einen Teilchenbeschleuniger keine 10 Tage lang mit Strom versorgen). Müssten sie fürchten, dass der Bund der Steuerzahler sich darüber mit der Begründung beschwert, man wisse doch bereits, dass es unterschiedliche Elementarteilchen gebe? Wahrscheinlich nicht. Weiterlesen
Archiv des Autors: Anatol Stefanowitsch
Satz und Sieg
Seit ein paar Wochen sucht die Initiative deutsche Sprache gemeinsam mit der Stiftung Lesen den „Schönsten ersten Satz“ eines deutschsprachigen Romans. Noch bis zu 21. September 2007 kann man seinen Vorschlag online einreichen. Insgesamt gefällt mir diese Aktion. Der erste Satz eines Romans entscheidet ja oft darüber, ob man überhaupt weiterliest (zumindest, wenn man, wie ich, eine kurze literarische Aufmerksamkeitsspanne hat). Und wenn es einen schönsten solchen Satz gibt, dann ist der Versuch, ihn in einem deutschsprachigen Roman zu finden, eine schöne Art, sich für die deutsche Sprache zu begeistern ohne dabei auf anderen Sprachen herumzuhacken.
Aber ganz ohne Nörgeln geht es trotzdem nicht. Erstens: was hat ein Handballtrainer in der Jury zu suchen? Ich bin durchaus sportbegeistert (für die Bundesliga kann ich sehr viel mehr Ausdauer aufbringen als für die Klassiker der amerikanischen Gegenwartsliteratur, und obwohl ich kein großer Handballfan bin, bin ich auf „unseren“ Weltmeistertitel natürlich stolz). Aber warum Sport und Kultur ständig in einem Atemzug gedacht und genannt werden ist mir trotzdem ein Rätsel. Zweitens: es wird der schönste erste Satz eines deutschen Romans gesucht, und der erste Preis ist dann ausgerechnet eine Reise nach New York?
Presseschau
Sprachblogleser NvonX hat mich auf diese schöne Geschichte hingewiesen: Wer beim deutschen Apple Store nach einer „Grafikkarte“ sucht, wird strengstens zur Ordnung gerufen: „Die Suche nach unangemessenen Wörtern wird nicht unterstützt“, teilt einem die Suchmaschine mit, bevor sie mitteilt, dass keine Ergebnisse gefunden wurden und dass man doch bitte die Schreibweise der Suchwörter überprüfen solle. Weiterlesen
Anatol Columbus
Mein Beruf bietet sich nicht unmittelbar dazu an, seinen Kindern davon zu erzählen, was man eigentlich den lieben langen Tag so macht. Am ehesten kann man ihnen wohl den Aspekt der Lehre vermitteln („Ich bin ein Lehrer für Erwachsene“). Irgendwie hat sich meine Tochter trotzdem einen Eindruck davon gebildet, dass da noch mehr dazu gehört. Weiterlesen
Paint It, Pink
In vielen asiatischen Ländern dient die englische Sprache rein dekorativen Zwecken. Das lateinische Alphabet und die englische Orthografie scheinen dort ein ähnliches ästhetisches Empfinden anzusprechen, wie es chinesische Schriftzeichen bei uns tun. Der Inhalt spielt dabei keine Rolle. Die Macher von T‑Shirts, Taschen und Postern werfen oft mit völlig beliebige Wörter und Pseudowörter um sich, oder sie klauen Absätze aus verschiedenen Quellen und kombinieren sie zu inkongruenten Textcollagen. Weiterlesen
Zerstörerische Briten
Sonntags räume ich immer meinen Spamordner auf und dabei ist mir heute dieser schöne Satz aufgefallen:
Du bist als einer von zwei Siegern des BRITISCHEN NATIONALEN LOTTERIE-Computerstimmzettels zeichnest vorgewählt worden und folglich bist du eine privilegierte Empfänger des großartigen Betragpreiss von £650,412.00 (sechs hundert und fünfzig tausend vierhundert und zwölf Briten zerstoßen Sterling), im Bargeld.
„Warum tun die das?“ habe ich mich natürlich sofort gefragt. Wozu brauchen die zerstoßenes Geld oder zerstoßene Autos oder zerstoßene Maschinengewehre oder zerstoßene Katzen oder zerstoßene — gut, ich hör’ ja schon auf. Weiterlesen
Presseschau
Die taz berichtet über neue Entwicklungen im Feminismus, der scheinbar mit gesellschaftlichen Veränderungen nicht mithalten konnte und „irgendwie daneben herumsteht“. Das will der Sammelband Das F‑Wort. Feminismus ist sexy (Hg. Mirja Stöcker, Königstein, 2007) ändern, indem die Autor/innen versuchen, „den Freiheitsbegriff des alten Feminismus aus seinen identitätspolitischen Fängen zu befreien, ohne ihn deshalb aufzugeben“. Weiterlesen
Schadenfreude
Letzte Woche habe ich über Don DeLillo und ungewöhnliche Kombinationen von Gefühlen geschrieben und dabei das deutsche Lehnwort schadenfreude im Englischen erwähnt.
Zur Erinnerung, das Cambridge Advanced Learners Dictionary definiert dieses Lehnwort wie folgt:
schadenfreude
noun [U]
a feeling of pleasure or satisfaction when something bad happens to someone else
Ein Gefühl von Freude oder Befriedigung also, wenn jemand anderem etwas Schlechtes zustößt. Weiterlesen
Alles geht, oder?
„Für Deskriptivisten gibt es kein Richtig oder Falsch. Alles geht.“ So hat eine meiner Studentinnen kürzlich in einer Seminardiskussion den Begriff Deskriptivismus definiert.
Nein. Auch Deskriptivisten unterscheiden zwischen „richtigen“ und „falschen“ Strukturen. Der Unterschied zwischen Deskriptivisten und Präskriptivisten liegt in der Grundlage, auf der sie diese Unterscheidung treffen. Für Präskriptivisten ist ein sprachlicher Ausdruck „falsch“, wenn er irgendwelche von Außen aufgesetzten Normen verletzt (sie sehen Sprache als eine Sammlung von Benimmregeln). Für Deskriptivisten ist ein sprachlicher Ausdruck „falsch“, wenn er den Regeln widerspricht, denen die Sprecher der Sprache unbewusst folgen (sie sehen Sprache als eine komplexe kognitive Fähigkeit). Weiterlesen
Telefonischer Sprachverfall
Vor ein paar Wochen ist die Geschichte schon durch die irische Presse gegangen, jetzt hat der Südkurier sie aufgegriffen: die schulischen Leistungen der irischen Jugend leiden unter dem Einfluss moderner Kommunikationstechniken. Zumindest behauptet das ein Bericht, den das irische Bildungsministerium in Auftrag gegeben hat: Weiterlesen